Alles, was ich zuvor über Indianerreservate wusste, kannte ich aus Büchern oder aus dem Internet. Man erfährt im Allgemeinen nicht allzu viel. Hauptsächlich sind es Zahlen, die die Reservationen zu beschreiben versuchen. Informationen, verpackt in Prozentzahlen: Arbeitslosenquoten, Alkoholismusraten, Angaben zum Einkommen, Diabetesraten, etc. Keine Frage: Das Bild eines Indianerreservates sieht nicht besonders rosig aus.
Doch nun bin ich vor Ort, und was erzähle ich Euch? Dass wir uns im ärmsten Landkreis der USA befinden. Dass 65 % bis 85 % der Einwohner arbeitslos sind, und wahrscheinlich ebenso viele alkoholabhängig. Dass im Durchnschnitt einer von fünf Jungen und eines von drei Mädchen missbraucht werden. Dass die Temperaturen im Winter so weit unter Null fallen, dass hier vor einigen Jahren an die 300.000 Kühe im Stehen erfroren sind.
Doch dies sind ebenfalls Zahlen. Sie bilden die eine Seite der Realität. Es gibt da aber noch die andere Seite, die von den traurigen Zahlen wenig vermuten lässt. Diese Seite ist definiert von der Mentalität der Einwohner hier, die sich vor allen Dingen durch eines auszeichnet: Humor. Die Menschen sind freundlich, lachen viel und reißen einen Witz nach dem anderen.
Doch nun bin ich vor Ort, und was erzähle ich Euch? Dass wir uns im ärmsten Landkreis der USA befinden. Dass 65 % bis 85 % der Einwohner arbeitslos sind, und wahrscheinlich ebenso viele alkoholabhängig. Dass im Durchnschnitt einer von fünf Jungen und eines von drei Mädchen missbraucht werden. Dass die Temperaturen im Winter so weit unter Null fallen, dass hier vor einigen Jahren an die 300.000 Kühe im Stehen erfroren sind.
Doch dies sind ebenfalls Zahlen. Sie bilden die eine Seite der Realität. Es gibt da aber noch die andere Seite, die von den traurigen Zahlen wenig vermuten lässt. Diese Seite ist definiert von der Mentalität der Einwohner hier, die sich vor allen Dingen durch eines auszeichnet: Humor. Die Menschen sind freundlich, lachen viel und reißen einen Witz nach dem anderen.
Thanksgiving: Douglas Familie hat uns Volontäre zum großen Lunch in den Gemeinschaftsraum einer Kirche eingeladen. Hinzu kommt Mandis Familie, die zu Besuch ist. Von Douglas Verwandten ist noch nicht jeder eingetroffen (Indian Time!). Dougs Vater furz-trocken: “We can’t start eating yet. You white guys are outnumbering us. We have to wait for more Indians!”
Die Realität IST hart und traurig, die Zahlen stimmen. Doch die Reservatsbewohner sind Indianer! Wer 500 Jahre Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung überlebt hat, wird sich auch in der Moderne nicht ergeben. Und das ist die schöne Neuigkeit: Die Indianer haben ihren Stolz behalten! Man sieht es ihnen an, man hört es ihnen an, und selbst, wenn man sich Ohren und Augen zuhielte, so würde man es dennoch spüren: Die Tradition liegt immer noch in der Luf: Powwows, Sonnentänze, Trommeln und Spiritualität. Alle Häuser und Gebäude, in denen ich bisher war, sind voller indianischer Kunstwerke, die Menschen tragen Jacken, Pullover und T-Shirts mit dem Stammeslogo auf dem Rücken, Handgelenke, Ohren und Hals sind behangen mit indianischem Schmuck, aus den Autos dröhnt lautstarke Powwowmusik bei herab gelassenem Fenster (naja, die meisten Autos haben gar kein Fenster mehr), im Sommer sitzt man im Garten und singt zum Trommelschlag, überall gibt es Kappen und Kleidungsstücke zu kaufen mit den beiden vielsagenden Worten “Native Pride”, dazu Aufkleber in Massen (“Official Indian Car”, “I was Indian before being Indian was cool”) und zig T-Shirts mit Sprüchen wie “Fighting Against Terrorism Since 1492”. Wird man auf offener Straße von Fremden angequatscht (was häufig vorkommt,) erzählen diese stolz von ihrer Kultur und Sprache. Ja, wer Lakota kann, gibt richtig damit an! Der Akzent hier ist übrigens echt süß. Ich meine nicht den Rez-Slang, den die Kids mit Vorliebe verwenden und der mir große Verständnisschwierigkeiten bereitet, sondern den Akzent der älteren Generation, die zum größten Teil flüssig Lakota spricht. Bei ihnen ist die englische Sprache vom Klang des Lakota deutlich beeinflusst, was zu einem wunderschönen Akzent führt. Oft verwendet man in der alltäglichen Kommunikation Lakota-Wörter, um damit Gefühle zu betonen, die das Englische nicht befriedigend auzudrücken vermag. Es gibt sogar einige Radiosender, die ausschließlich in Lakota ausgestrahlt werden.
Die Lakota-Sioux haben sieben Tugenden: Gebet, Respekt, Mitgefühl, Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und Weisheit. Diese Tugenden bestimmen jeden einzelnen Aspekt im traditionellen Leben und in der Kultur der Lakota. Bei jedem öffentlichen Anlass wird gemeinsam gebetet. Dazu stehen alle auf, während eine ältere, anerkannte Person das Gebet spricht, in das sich meist viele Wörter in Lakota einschleichen. Beonders aber habe ich die Tugenden Mitgefühl und Großzügigkeit kennen gelernt. So kamen nach unserem üppigen Erntedankfest fünf Obdachlose in den Gemeinschaftsraum der Kirche und luden sich Teller mit Essen voll. Nicht, weil sie unverschämt waren, sondern weil es bei den Lakota so Sitte ist: Jeder Mensch hat ein Recht auf eine Mahlzeit und auf ein Dach über den Kopf. So verwehrt man auch keinem Fremden den Eintritt ins Haus, sondern gewährt ihm Obdach.
Eine lustige Geschichte: Die Familie meiner Chefin gab einmal eine Feier in kleinem Kreise. Es kamen zwei fremde Indianer vorbei, die sich wie alte Kumpels verhielten. Man aß und trank zusammen und hatte reichlich Spaß. Am Abend bedankten die Fremden sich und verschwanden. Als man sich anschließend gegenseitig fragte, “Did you know them?”, schüttelte jedermann verwundert den Kopf.
Parallel zu den sieben Tugenden gibt es sieben Zeremonien. Die wichtigsten sind das Inipi (die Schwitzhütten-Zeremonie), die Hunkapi (eine Zeremonie, die es Stammesmitgliedern erlaubt, Nicht-Stammesangehörige in ihre Familie zu adoptieren), das Wiwanyag Wacipi (die Sonnentanz-Zeremonie) und die Hanbleciya (die Visionssuche). (Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich für die Lakota-Begriffe die passenden Artikel benutze... Deutsch kann kompliziert sein, da lobe ich mir doch das englische “the”!). Die mächtigste Zeremonie der Lakota ist der Sonnentanz, der meistens unter den Sommermonaten stattfindet. Menschen, die nicht zum Stamm der Lakota gehören, ist es meist verwehrt, dieser Zeremonie beizuwohnen (geschweige denn, daran teilzunehmen), da der Sonnentanz eine extrem heilige Angelegenheit ist. Überhaupt sollte jedermann akzeptieren, dass die Religion der Lakota auch nur für diese bestimmt ist, und dass die Teilnahme von anderen Kulturen gegen die Religion wirken und für Ungleichgewicht sorgen kann.
Wer dennoch ein wenig am kulturellen Leben der Indianer teilhaben möchte, sollte sich den Besuch eines Wacipis (Powwows) nicht entgehen lassen. Diese finden ebenfalls hauptsächlich im Sommer und draußen statt. Hierzu bewegen sich Tänzer aus allen Altersgruppen in traditioneller oder kunstvoller, modernerer Lakota-Tracht zur Trommelmusik, die von den männlichen Stammes-mitgliedern – jung und alt – gespielt und gesungen wird. Jeder Song und jeder Tanzstil gibt einen genauen Rhythmus, bzw. eine bestimmte Bewegung vor, an die die Musiker und Tänzer sich halten müssen. Oft gibt es großzügige Preisgelder für die besten Tänzer. Obwohl das Wacipi keine Zeremonie darstellt, lassen sich auch hier zeremonielle Aspekte wieder finden, wie zum Beispiel die Ehrung einer Person oder Gruppe. So bilden die Kriegsveteranen stets einen wichtigen Bestandteil des Grand Entry, bei dem alle Tänzer die Arena als Gruppe betreten und gemeinsam tanzen, bevor der eigentliche Wettbewerb beginnt.
Andere soziale Ereignisse sind Tanzabende im Gemeinschafts-zentrum (in Eagle Butte das Cultural Center), öffentliche politische Treffen, Paraden (in die sich weiße Hula-Hula-Tussis verirren können....hehe) und sogar Beerdigungen. Stirbt jemand aus der Gemeinde, so ist die Chance groß, dass fast jeder Einwohner die Person kannte (wie in meinem Heimatort). Doch hier bleiben manchmal sogar Geschäfte und Schulen geschlossen, damit jeder die Möglichkeit hat, an der Beerdigung teilzunehmen!
In den kleinen Ortschaften der Reservation wird das Wort Gemeinschaft groß geschrieben und man pflegt gewissenhaft Freundschaften und Bindungen. So findet seit einigen Wochen in Rockys Haus jeden Donnerstag die “Survivor" - Night statt. Offizieller Vorwand ist, dass man sich einmal die Woche zum Dinner trifft und sich diese (meiner Meinung nach überaus hohle) Sendung beim Essen reinzieht. Der eigentliche Grund ist jedoch die Aufrechterhaltung der Familiengemeinschaft während der kalten Wintermonate. Egal, wie dämlich die TV-Show ist, ich liebe und schätze es, bei Kaminfeuer und Festschmaus und mit Wokini auf dem Schoß den Wert der Community jede Woche aufs Neue zu erfahren.
Da ich ein Landei bin, habe ich mit dem Kaff-Charakter Eagle Buttes zum Glück kein Problem. Ich liebe es, spazieren zu gehen und mir die Gegend anzuschauen: schöne Häuser, schäbige Häuser, gepflegte Gärten, Müllhalden um das komplette Haus herum, riesige Pick Ups, alte (aber schöne!) Karren kurz vor dem Zusammenfall und bedeckt mit Einschusslöchern, Wohntrailer, in denen bis zu zehn Personen “wohnen”, und: überall Hunde! Manche hat man in der Zeit zum Freund gewonnen, während andere versuchen, dir beim Fahrradfahren ins Bein zu beißen. Es gibt da einen lieben, schwarzen Hund, der mich oft zum LTM begleitet. Ich habe stets Mühe, ihn davon abzuhalten, mir nicht auch noch in den Supermarkt zu folgen.
Ist man zu Fuß unterwegs, (und wir Volontäre sind, abgesehen von den Obdachlosen, die einzigen, die hier zu Fuß unterwegs sind) winken uns viele Leute zu oder hupen gar wild drauf los. In 99% der Fälle habe ich keine Ahnung, wer das ist. Doch als (deutsche) Main-Arbeiterin ist man hier schnell bekannt (und die Teletubby-Nummer hat meinen Bekanntheitsgrad sichtlich erhöht). Wobei es gar nicht so lustig ist, Deutsche zu sein. Erstens wegen unserer beschämenden Vergangenheit, und zweitens wegen der extrem romantischen Indianervorstellung der meisten Deutschen (Karl May sei Dank). Auf der Verblendungsskala von 1 bis 10 befinden wir Deutschen uns auf 11, wenn es um das Bild des Indianers geht. Das Main hat jedes Jahr viele Freiwillige aus Deutschland, und viele von ihnen kommen aus den absurdesten Gründen hier hin: Sie wollen sich einen indianischen Mann angeln, sind auf der Suche nach ihren Seelenverwandten oder hegen die Hoffnung, adoptiert zu werden und einen indianischen Namen zu erlangen. Und da es von dieser Sorte hier schon einige dolle Beispiele gegeben hat, fällt es mir ehrlich gesagt ein wenig schwer, meine Herkunft preiszugeben und mich als Deutsche zu outen. Viele Menschen fragen mich, warum so viele Deutsche ins Reservat kommen, und warum wir Deutschen so indianerverrückt sind. Ich antworte jedesmal achselzuckend: “I think it’s because of Karl May.” (Woraufhin jeder fragt: “Whoooo?”) Meine Erklärung ist im Grunde genommen äußerst absurd, in Anbetracht der Tatsache, dass ich noch nie im Leben ein Buch von Karl May gelesen habe. Aber schon als Kind habe ich Nase rümpfend den Sender gewechselt, wenn Winnetou über den Bildschirm hoppelte, obwohl ich damals sicherlich noch nicht einmal das Wort Stereotypie aussprechen konnte. Auch ich kann mich natürlich nicht von romantisierender Indianerliteratur freisprechen, doch ich kann sagen, dass ich Glück hatte: Mit etwa 18 Jahren fiel mir ein Buch von Sherman Alexie in die Hände, und von da an war ich verliebt in seine Prosa und Poesie. Der Coeur d’Alene/Spokane Indianer ist ein Meister der Ironie und ist bekannt für seine humorvollen, oft sarkastischen Geschichten über das Leben heutiger Indianer. Der Autor, der mittlerweile vom Spokane-Reservat in Washington nach Seattle gezogen ist, ist ein Meister in der authentischen Darstellung des Lebens heutiger Reservats- und Stadtindianer, die dennoch mit fiktionalen Elementen durchzogen ist, so dass man seine Kurzgeschichten und Romane als “Reservations-Realismus” bezeichnen könnte. Aber ich verliere wie immer beim Thema Sherman Alexie vor lauter Schwärmerei den roten Faden und komme nun zurück zur Cheyenne River Reservation.
Ich hatte keine Ahnung, was mich hier erwarten würde. Ich bin zwar (hoffentlich) weitgehend unverblendet ins Reservat gekommen, doch hatte ich keine genaue Vorstellung von diesem Ort. Und wenn ich mir vor meiner Ankunft das Reservat gedanklich ausmalte, so verwendete ich stets die Bilder, die mir beim Lesen von Alexies Kurzgeschichten in den Sinn kamen.
Die Realität hat mich umgehauen! Alles ist genau so, wie Alexie es in seinen Büchern beschreibt! Diet Pepsi, Basketball, Trommelschlag, Monotonie, Langeweile, Verrücktheit, und auch hier vor allen Dingen eines: Humor. Den schreibt der Autor besonders groß.
“Humor is self-defense on the rez. You make people laugh and you disarm them.” (SHERMAN ALEXIE)
Im Grunde fühle ich mich in Alexies Prosa versetzt. Und ich kann euch nicht beschreiben, was für ein Gefühl es ist, sich selbst in den Geschichten wieder zu finden, die man so oft gelesen hat, dass man sie beinahe auswendig kann. Es macht mich glücklich.


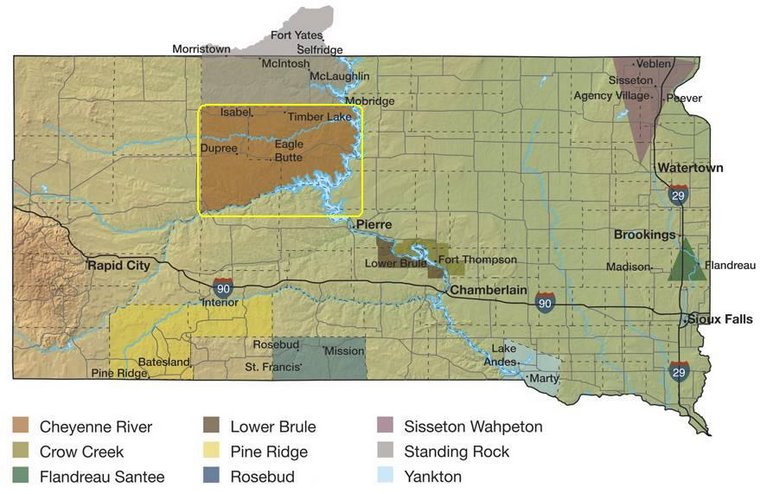
.JPG)

.JPG)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen